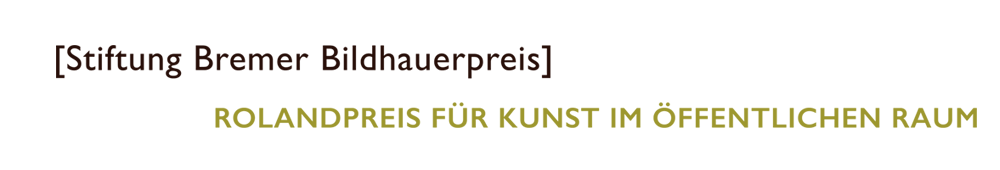Der Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum 1990 geht an Jochen Gerz, der 1940 in Berlin geboren wurde und in Paris lebt.
»Das Preisgericht hat ihn für das mit seiner Frau Esther Gerz erarbeitete ‚Harburger Mahnmal gegen Faschismus, Krieg, Gewalt Das Mahnmal ist eine 12m hohe, bleiummantelte Säule, auf der sich die Passanten mit Hilfe von vier Stahlstiften verewigen können. In dem Maße, in dem die Zahl der Unterschriften wächst, soll die Säule ’, das 1986 entstanden ist, ausgezeichnet. Das Mahnmal ist eine 12m hohe, bleiummantelte Säule, auf der sich die Passanten mit Hilfe von vier Stahlstiften verewigen können. In dem Maße, in dem die Zahl der Unterschriften wächst, soll die Säule abgesenkt werden, bis sie schließlich im Erdboden verschwunden ist; denn, so die Schlussfolgerung des künstlerischen Konzepts, ‚nichts kann auf Dauer an unserer Stelle sich gegen das Unrecht erheben’. Das Preisgericht ehrt mit dieser Arbeit ein originäres Projekt für Kunst im öffentlichen Raum, das im Reflex auf das klassische Mahnmal dessen Fragwürdigkeit heute aufzeigt, das sich nicht ästhetisch in seine Umgebung integrieren und somit das Erinnern in einem formalen Akt aufheben will, sondern Mahnung und Erinnerung als einen sozialen Prozess versteht. Je mehr sich daran beteiligen, umso obsoleter wird das Mahnmal selbst. Es muss schließlich verschwinden. Die Jury sieht diese erste Arbeit, die Jochen Gerz zusammen mit seiner Frau im öffentlichen Raum gemacht hat, in einem engen Zusammenhang mit der Thematik seiner ganzen Arbeit und in konsequenter Fortsetzung von Installationen wie z.B. ‚Exit/Materialien zum Dachau-Projekt’ von 1987. Es geht um Erinnerungsarbeit, die von dem täglichen Bild- und Sprachausstoß der Medien verhindert und zugeschüttet wird. Jochen Gerz versucht mit seiner Kunst gegen die tägliche Kulturarbeit des Ausgrenzens und Auslöschens anzuarbeiten, gegen eine Vorstellung von Kultur, die ihre Leistungen nur an ihren Images und Ideologien misst.«
(Begründung des Preisgerichts, 1990)
Jochen Gerz führte in der Zeit von 1990 bis 1995 die
»Die Bremer Befragung – SINE SOMNO NIHIL« durch.

Jochen Gerz arbeitete über vier Jahre hinweg mit ausgewählten Bevölkerungsgruppen. Er verschickte 50.000 Fragebögen in denen er danach fragte, welche Themen eine künstlerische Arbeit für Bremen haben sollte, ob die Kunst solchen Themen gerecht werden kann und wer an dieser Arbeit mitwirken möchte. 269 Bremerinnen und Bremer haben geantwortet und mit ihm diskutiert. Die Befragung war für Gerz kein Mittel zum Zweck, sondern das Kunstwerk selbst, das er als „immaterielle Skulptur“ bezeichnete. Es sollte über die Diskussionen in den Köpfen der Menschen entstehen. Den Diskurs in Bremen veröffentlichte er in der Schrift „Die Bremer Befragung. The Bremen Questionaire. Sine Somno Nihil, 1990 – 1995“, Herausgeber: Peter Friese, Weserburg. Museum für moderne Kunst, Autor: Jochen Gerz, 1995.
Gleichzeitig gravierte der Künstler als Zeichen und öffentliche Erinnerung die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine gläserne Bodenplatte (200 cm x 116 cm ), die am Boden des Brückengeländers der Bürgermeister Smidt Brücke aufgebracht ist. In die Bodenplatte ist der Text eingearbeitet: „Die Bremer Befragung ist eine Skulptur. Sie besteht aus den Bildern und Träumen derer, die sie sich vorstellen. Alle, die dies tun, sind ihre Autoren. Die Bremer Befragung ist ihren Autoren gewidmet und allen, die hier stehen bleiben und etwas sehen, was es nicht gibt.“